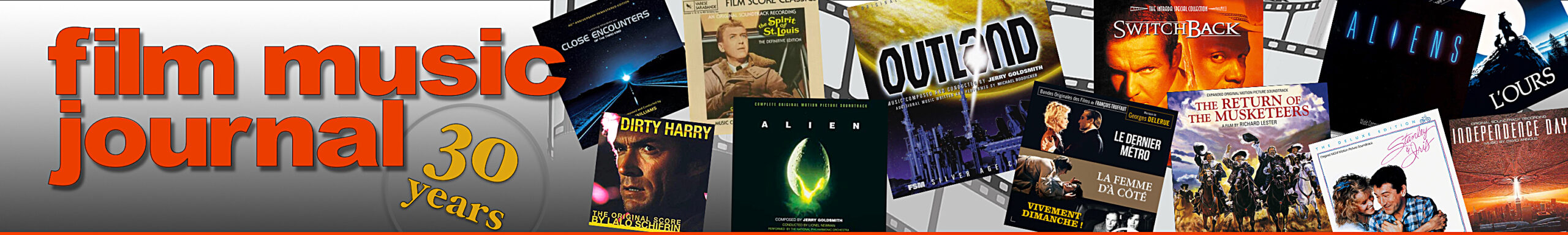Bereits in der ersten Minute wird der Zuschauer Zeuge des qualvollen Todes einer jungen Frau. Während der Vollmond die schneeverhangene Naturkulisse in ein unwirkliches Licht taucht, hetzt die Frau verängstigt und barfuß durch die Wälder. Es dauert nicht lange, da bricht sie zusammen. Gefunden wird sie einige Stunden später von dem Jäger Cory Lambert. Das Brisante an dem Fall: Die junge Frau ist Indianerin und wurde in einem ebensolchen Reservat gefunden. Ein Fall für das FBI. In der Vermutung, es mit einem Routinefall zu tun zu haben, schickt man die junge, unerfahrene Agentin Jane Banner, die wiederum den Jäger um Hilfe bittet. Bald zeigt sich dieser als zutiefst traumatisierter Mann, dessen Tochter, eine Halbindianerin, drei Jahre zuvor unter ähnlichen Umständen ums Leben kam.
Eigentlich begann die Hollywood Karriere des hier regieführenden Taylor Sheridan als Schauspieler, doch die entwickelte sich nur mäßig erfolgreich. Seine bis dato größte Rolle war jene als integrer Sheriff in der hochgelobten Rockerserie „Sons of Anarchy“. Vielleicht liegt hierin auch Sheridans Vorliebe für kantige Männergeschichten begründet, denn nachdem weitere Rollen ausblieben, begann der gebürtige Texaner sich als Drehbauchautor auszuprobieren. Gleich mit seinem Debütbuch, dem Drogenthriller „Sicario“, schlug er in Hollywood ein wie eine Bombe. Der Verfilmung seines nächsten Buches, „Hell or High Water“, war zwar an den Kinokassen nicht annähernd so erfolgreich, bescherte Sheridan allerdings eine Oscar Nominierung und die Möglichkeit, bei der Umsetzung seines nächsten Drehuches gleich selbst auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen. Wie bereits bei den Drehbüchern zuvor liegt auch der Reiz der Geschichte, die Sheridan erzählt, weniger in der Raffinesse verwinkelter Storywendungen, sondern vielmehr in der Schilderung eines Milieus und den damit verbundenen Charakterzeichnungen.
„Wind River“ erzählt seine Krimihandlung erstaunlich gradlinig, interessiert sich im Grunde für selbige kaum. Insofern verwundert es nicht, dass man als Zuschauer bereits nach kurzer Zeit die Lösung erahnt und Sheridan diese bereits nach rund 1 Stunde dem Publikum präsentiert. Was indes fasziniert ist die Schilderung des Lebens in dieser wenig einladenden Landschaft, mit dem sich die Protagonisten auseinandersetzen müssen und was es aus ihnen macht. Einerseits scheinen die klimatischen Bedingungen dieser rauen Landschaft die Menschen resoluter und widerstandsfähiger zu machen, andererseits fordert die Abgeschiedenheit auch ihren Tribut in Form von Einsamkeit, die sich auf jeden anders auswirkt. Das ist besonders tragisch, da auch das Mordopfer sowie die Tochter des Jägers Cory Lambert, dieser damit verbundenen Einsamkeit indirekt zum Opfer fielen. Das Erzähltempo ist entsprechend der Monotonie dieses ländlichen Lebens ruhig und entwickelt einen fast meditativen Sog, wodurch es dem Regisseur Sheridan gelingt, den Zuschauer knapp zwei Stunden zu fesseln. Der Film entführt den Betrachter in ein „White Trash“ Amerika abseits der bekannten Trailerparks, stattdessen in die Reservate amerikanischer Ureinwohner, deren Leben von Alkohol und/oder Drogenhandel geprägt ist. In diesen Momenten erinnert er an den faszinierenden „Winter’s Bone“ mit Jennifer Lawrence.
Darstellerischer Mittelpunkt der Geschichte ist Jeremy Renner in der Rolle des Jägers Cory Lambert, der entgegen seines Parts im Superhelden Verein der „Avengers“ hier mal zeigen kann, dass er ein richtig guter Schauspieler ist. Mit sorgenvoll zerfurchter Knautschgesichtigkeit schafft er es, den Schmerz und die Traurigkeit seiner Figur greifbar zu machen. Deutlich undankbarer kommt hier Elizabeth Olsons Figur weg, Agentin Jane Banner. Konzipiert als Identifikationsfigur für den Zuschauer, die diesen in diese Welt mitnehmen soll, ist ihre Rolle mit wenig Hintergrund ausgestattet und erinnert dadurch an die von Emily Blunt dargestellte FBI-Agentin in dem Film „Sicario“. Das ist insofern Schade, da Olsons darstellerisches Potential nahezu ungenutzt bleibt und nur gelegentlich aufblitzen darf. Im Grunde konzentriert sich der Film fast ausschließlich auf Renners Figur, denn auch die Nebenfiguren verblassen und bleiben lediglich Stichwortgeber, um die Handlungsmotor am Laufen zu halten. Hätte Sheridan bei der Figurenentwicklung ähnlichen Wert gelegt wie auf die Etablierung des Settings und die Ausformulierung des Hauptcharakters, wäre „Wind River“ möglicherweise ein Meisterwerk geworden, so aber bleibt der Film ein ambitionierter Thriller, der zu unterhalten weiß, aber vor allem wegen Renner und seiner Atmosphäre in Erinnerung bleibt. Musik: Der Singer Songwriter Nick Cave hat sich bereits seit einigen Jahren einen guten Ruf als Filmkomponist gemeinsam mit seinem musikalischen Partner Warren Ellis erarbeitet. Ihr Markenzeichen sind hierbei atmosphärische Tonbegleitungen, die durch sich wiederholenden musikalischen Phrasen oftmals einen hypnotischen Sog entwickeln. Die Musik von „Wind River“ bleibt sich diesem Gestus treu. Sie verstärkt die Traurigkeit und Melancholie des Gezeigten. Melodien werden angedeutet, aber kaum ausformuliert, sodass die Musik abseits des Films durchaus eines emotional robusten Hörers bedarf, um diesen nicht in Depressionen zu stürzen. Im Film indes erfüllt sie exzellent ihre Aufgabe. Der Soundtrack ist sowohl als Download als auch auf Silberling erhältlich und umfasst 23 Titel.
![]() Dennis, 5.1.2018
Dennis, 5.1.2018

WIND RIVER
Regie: Taylor Sheridan
Darsteller: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Kelsey Asbille, Gil Birmingham, Graham Greene
Musik: Nick Cave, Warren Ellis
Verleih: Ascot Elite/Universum Film
Erscheinungsdatum: 8. Juni 2018